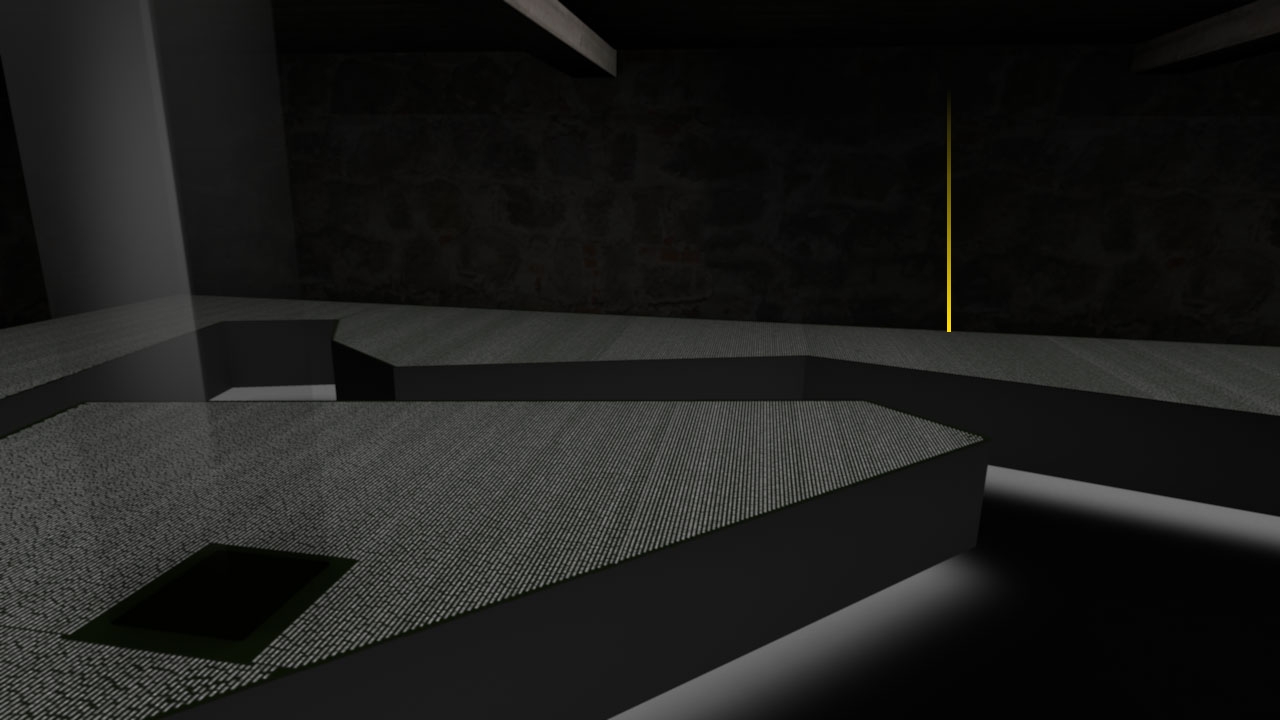Friedrich Plaichner 1901 - 1945
Geboren 15.6.1901 in Traismauer
Gestorben 28.4.1945 in Mauthausen
Biografie
Friedrich Plaichner
(abweichende Schreibweisen: Blaichner, Pleichner)
Geboren am 15.6.1901 in Traismauer
Gelebt von 1926 bis 1944 in Wels
Gestorben am 28.4.1945 im KZ Mauthausen
Friedrich „Fritz“ Plaichner war einer jener 42 Männer, die am 28. April 1945 in der Mauthausener Gaskammer ermordet wurden – es war dies die letzte Vergasung vor der Befreiung. Der Gauleiter von „Oberdonau“, August Eigruber, hatte offenbar in Absprache mit Ernst Kaltenbrunner und dem Mauthausen-Kommandanten Franz Ziereis beschlossen, den vorrückenden Alliierten sollten keine politisch „gefährlichen“ Häftlinge in die Hände fallen.
Für die Vergasung am 28. April waren 43 Männer vorgesehen, zum größten Teil oberösterreichische Widerstandskämpfer. Doch ein Mann, Richard Dietl, konnte sich retten und wurde für viele der 42 Ermordeten zum einzigen Zeugen – so auch für Fritz Plaichner, der keinen „großen Namen“ hatte.
1901 bis 1941: Eisenbahner, Ehemann, Vater
Fritz Plaichner wurde am 15. Juni 1901 im niederösterreichischen Traismauer geboren. Im Jahr 1926 zog er nach Wels und arbeitete als Schlosser bei den Bundesbahnen Österreich – einige Jahre später wurde er Lokomotivführer. Er war beim Umzug bereits mit der um drei Jahre jüngeren Maria verheiratet, die im Jahr 1927 in Wels dann die gemeinsame Tochter Hermine zur Welt brachte. Wahrscheinlich Ende 1932 ließ sich das Ehepaar scheiden, und Fritz Plaichner zog Anfang 1933 in der Wohnung einer anderen Frau, Aloisia R., ein – ob zunächst nur als Untermieter oder bereits als Lebensgefährte, lässt sich nicht sagen, aber einige Jahre später wurde Aloisia R. jedenfalls zu seiner zweiten Ehefrau.[1]
Aloisia R., geboren 1900, Textilarbeiterin von Beruf, war in Wels als Abtreiberin „stadtbekannt“. Sie war mehrfach wegen illegaler Abtreibungen, die sie an anderen Frauen gegen Entgelt durchgeführt hatte, vorbestraft – und verbüßte auch in jener Zeit, in der die Bekanntschaft mit Fritz Plaichner begonnen hatte, einige Gefängnisstrafen. Aloisia R. war ebenfalls bereits geschieden und hatte in sehr jungen Jahren drei Kinder geboren, von denen damals, als Fritz Plaichner bei ihr einzog, zumindest noch zwei im gemeinsamen Haushalt lebten.[2]
Am 18. November 1938 heirateten Fritz und Aloisia, und am 17. Dezember 1938 kam ihr Sohn Friedrich Alois zur Welt.
Kurz zuvor war in der Neuverhandlung einer Strafsache am Landesgericht Wels gegen Aloisia R. entschieden und eine sechsmonatige Kerkerstrafe bestätigt worden. Die Geburt des Kindes bewirkte einen Haftaufschub. Allerdings wurde Aloisia R., nunmehr Aloisia Plaichner, im Juni 1939 erneut gerichtlich wegen einer Abtreibung verurteilt, und zwar zu 18 Monaten schwerem Kerker. Ungefähr zur selben Zeit dürfte sie die insgesamt nun zweijährige Freiheitsstrafe angetreten sein, was bedeutet, dass Fritz Plaichner ab dem Sommer 1939 mit dem Baby allein war.
Ende Mai oder Anfang Juni 1941 wurde Aloisia Plaichner als sogenannte „Berufsverbrecherin“ ins Frauen-KZ Ravensbrück eingeliefert. Falls Fritz und Aloisia sich noch einmal wiedergesehen haben, so könnte es höchstens zwischen Strafhaft und Deportation im Polizeigefängnis von Wels oder Linz gewesen sein, wo sie auf den „Sammeltransport“ warten musste. Belegen lässt sich eine solche letzte Begegnung aber nicht.
1941 bis 1945: Widerstandskämpfer, KZ-Häftling
Fritz Plaichner schaffte es vor allem mit der Hilfe von Luise R., Aloisia’s mittlerer Tochter aus erster Ehe, das Baby Friedrich Alois zu versorgen.
Über seine politische Vorgeschichte und seine Widerstandstätigkeit im Nationalsozialismus ist derzeit leider nichts bekannt – weder wann er sich dem Widerstand in Wels angeschlossen hat, noch was er geleistet hat, kann gesagt werden. Es kann nur vermutet werden, dass er als Mitarbeiter der Eisenbahn am ehesten zum sozialistischen Widerstand zählte[3] – aber genauso gut kann er Kommunist gewesen sein oder gar keiner Partei angehört haben. Und es kann nur spekuliert werden, ob er wegen der Sorgepflicht für das Baby und der KZ-Deportation seiner Ehefrau vielleicht gezögert hat, sich dem lebensgefährlichen Widerstand anzuschließen? Oder ob er gerade deshalb gleich etwas gegen das nationalsozialistische Terrorregime unternehmen wollte?
Sicher ist nur, dass Fritz Plaichner im Oktober 1944, wahrscheinlich direkt von seiner Arbeitsstelle am Welser Bahnhof weg, von der Linzer Gestapo verhaftet wurde. Er fiel einer großen Verhaftungsaktion zum Opfer, die von September bis Dezember 158 Männer und Frauen der von der Gestapo so bezeichneten „Welser Gruppe“ betroffen hatte.[4] Die Gestapo war es auch, die Fritz Plaichner in ihren Dossiers als Mitglied einer sechsköpfigen „Reichsbahngruppe“ führte.[5]
Die allermeisten der verhafteten Männer wurden ohne Gerichtsverhandlung umgehend ins KZ Mauthausen eingeliefert. Fritz Plaichner wurde dort mit der Nummer 107582 registriert.
Ende April 1945 waren sehr viele seiner mit ihm eingelieferten Kameraden bereits nicht mehr am Leben. Und, wie eingangs berichtet, sollte in den Augen der Nazis kein Angehöriger der „Welser Gruppe“ den Krieg überleben. Fritz Plaichner wurde am 28. April 1945 in Mauthausen vergast. Der einzige Überlebende dieser Mordaktion, Richard Dietl, fertigte unmittelbar nach seiner Befreiung einen Bericht und eine Liste der Opfer an, auf der sich auch der Name von Fritz Plaichner findet.[6]
1945 bis 1954: Todeserklärung, Strafregister, „Entschädigung“
Seine Ehefrau Aloisia Plaichner kehrte nach fast vier Jahren Haft in verschiedenen KZ im Laufe des Mai 1945 nach Wels zurück. Sein Sohn Friedrich Alois war nun sechseinhalb Jahre alt.
Aloisia hatte Anspruch auf eine Witwenpension der Bundesbahnen (nunmehr: ÖBB), musste dafür aber die amtliche Todeserklärung ihres Ehemannes erwirken. Das Kreisgericht Wels stellte die Erklärung am 19. Juni 1946 mit folgender Begründung aus:
„Vom Kreisgerichte Wels wird [...] Friedrich Plaichner, Oberlokomotivführer [...], da er seit 26. April 1945 vermisst wird, an welchem Tage er sich im Konzentrationslager Mauthausen in höchster Todesgefahr befunden hatte, [...] für tot erklärt und ausgesprochen, dass der 28. April 1945 als jener Tag, den er nicht überlebt hat, anzusehen ist.“[7]
Ende des Jahres 1952[8] suchte Aloisia Plaichner für sich und den Sohn Friedrich Alois als Hinterbliebene des ermordeten Widerstandskämpfers Fritz Plaichner um Haftentschädigung und Opferrente an.[9] Da sie über den Leidensweg ihres Ehemannes kaum etwas wusste, begann das zuständige Amt der Oberösterreichischen Landesregierung mit Erhebungen.
Am 28. April 1953, also zufällig dem achten Todestag von Fritz Plaichner, wurde sein Strafregisterauszug erstellt.[10] Demnach fasste er 1924 einmal wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beamtenbeleidigung (§ 81 u. § 312 des Strafgesetzes) acht Wochen strengen Arrest aus. Und 1935 bekam er ebenfalls acht Wochen strengen Arrest für die „Verhehlung“ eines Verbrechens (§ 214), d.h. er hatte entweder über ein ihm bekanntes Verbrechen geschwiegen oder er hatte Verdächtige versteckt.
Beide dieser Strafen wurden auf zwei bzw. drei Jahre bedingt ausgesprochen, und alles deutet darauf hin, dass Fritz Plaichner die Bewährungsfristen eingehalten hat, die Strafen also nie absitzen musste.
In beiden Fällen kann es sich durchaus um politische Delikte gehandelt haben – 1924, also kurz bevor die Hyperinflation in Österreich durch die Einführung des Schilling gestoppt wurde, könnte es sich um die Teilnahme an einer Hungerdemonstration gehandelt haben.[11] 1935 könnte das „Verbrechen“, das er gedeckt hat, eines gegen den austrofaschistischen Ständestaat gewesen sein. Genauso gut kann es aber auch um rein kriminelle Delikte gegangen sein.
Im Zuge der weiteren Erhebungen der Landesregierung wurde im August 1953 eine Anfrage an die Welser Polizei gerichtet: „Der Gatte der Obgenannten [...] soll im Oktober 1944 am Bahnhof in Wels von Organen der Gestapo aus politischen Gründen verhaftet und später in das KZ Mauthausen eingeliefert worden sein.“[12] Es wurde nach eventuell vorhandenen Unterlagen und nach der Bestätigung des Verhaftungsgrunds gefragt.
In ihrer Antwort hielt die Welser Polizei fest, dass keine Unterlagen dazu vorhanden seien, und merkte an: „Es ist lediglich amtsbekannt, dass Plaichner im Herbst 1944 im Zuge einer Verhaftungswelle in Wels von Beamten der Gestapo Linz verhaftet und später in das KZ Mauthausen eingeliefert wurde. Er dürfte gleich nach seiner Verhaftung nach Linz überstellt worden sein, weil im hiesigen Polizeigefangenenhaus und im kreisgerichtlichen Gefangenenhaus Wels über eine Haft des Obgenannten keine Eintragungen vorhanden sind.“[13]
Im Dezember 1953 sprach schließlich Richard Dietl bei der Bezirkshauptmannschaft Wels vor. „Mir ist bekannt“, gab Richard Dietl zu Protokoll, „dass Fritz Plaichner im Oktober 1944 aus politischen Gründen verhaftet wurde und in das KZ Mauthausen eingeliefert wurde. Obgenannter war mit mir bis zu seiner Ermordung (28.4.1945) im selben Lager (Block 9) zusammen. Ich kann mit Gewissheit angeben, dass seine Verhaftung aus politischen Gründen erfolgte.“
Mehrere Wochen nach der Aussage wurde das Protokoll durch eine handschriftliche Aktennotiz ergänzt: „Richard Dietl ist Inhaber der Amtsbestätigung gem. § 4 und als vollkommen glaubwürdig amtsbekannt.“[14]
Tags darauf, am 26. Jänner 1954, wurde der positive Bescheid für den Antrag auf Haftentschädigung gefertigt. Demnach erhielten Aloisia und Friedrich Alois für die KZ-Haft ihres ermordeten Ehemannes und Vaters Fritz Plaichner insgesamt 1.509,20 Schilling. Sieben Haftmonate von Oktober 1944 bis April 1945 wurde dafür eingerechnet.[15]
Friedrich Alois Plaichner schloss im Februar 1957 eine Lehre als Kfz-Mechaniker ab und zog von zuhause aus.
Aloisia Plaichner starb am 11. August 1979 in einem Linzer Altersheim.
Sylvia Köchl
Sylvia Köchl ist Autorin des Buches „Das Bedürfnis nach gerechter Sühne“. Wege von „Berufsverbrecherinnen“ in das Konzentrationslager Ravensbrück (Mandelbaum Verlag, Wien 2016) und hat im Zuge ihrer Recherchen über Aloisia Plaichner Informationen über deren Ehemann Fritz zusammengetragen.
[1] Archiv der Stadt Wels, Meldekarteikarte von Friedrich Plaichner
[2] Alle Informationen über Aloisia R. aus: Sylvia Köchl: „Das Bedürfnis nach gerechter Sühne“ Wege von „Berufsverbrecherinnen“ in das Konzentrationslager Ravensbrück (Wien 2016).
[3] Michael Kitzmantel: Widerstand und Verfolgung in Wels – 1. Teil; in: Stadt Wels (Hg.): Nationalsozialismus in Wels. Bd. 1 (Wels 2008), S. 191–217.
[4] Siegwald Ganglmair: Widerstand und Verfolgung in Linz in der NS-Zeit; in: Fritz Mayrhofer/Walter Schuster (Hg.): Nationalsozialismus in Linz. Bd. 2 (Linz 2001), S. 1447 ff. (Abschnitt „Die Welser Gruppe“).
[5] Auskunft der KPÖ Wels von 2015.
[6] Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (AMM), Gedächtnisprotokoll von Richard Dietl (AMM V/03/43); siehe auch die Kurzbiografie von Josef Teufl, einem der Ermordeten: http://gedenkstaetten.at/raum-der-namen/cms/index.php?id=4&p=103180 (Zugriff am 3.11.2017)
[7] Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) 18497.
[8] Haftentschädigung gab es erst seit 1952 (aber nur für anerkannte Haftorte, so bspw. nicht für eine Internierung in den speziellen Lagern für Roma und Sinti.
[9] Für ihre eigene KZ-Haft konnte Aloisia Plaichner keine Opferfürsorgeansprüche stellen, da sie als „Berufsverbrecherin“ interniert worden war.
[10] Oberösterreichisches Landesarchiv (OÖLA), Opferfürsorgeakten, FOF 20/3–1954, Fahndungsamt der Bundespolizeidirektion Wien, Strafregisterauszug, 28.4.1953
[11] Vgl. z.B. Erik Eybl: „Von der Eule zum Euro. Nicht nur eine österreichische Geldgeschichte“ (www.geldschein.at/geschichte/inflationskronen-die-eiserne-zeit-1922.html, Zugriff am 3.11.2017).
[12] OÖLA, Opferfürsorgeakten, FOF 20/3–1954, Brief der oö. Landesregierung an das BPK Wels, 23.8.1953.
[13] Ebd., Brief des BPK Wels an die oö. Landesregierung, 9.9.1953.
[14] Ebd., BH Wels, Niederschrift mit Richard Dietl, 19.12.1953; Aktennotiz, 25.1.1954.
[15] Ebd., oö. Landesregierung, Bescheid, 26.1.1954.
Position im Raum