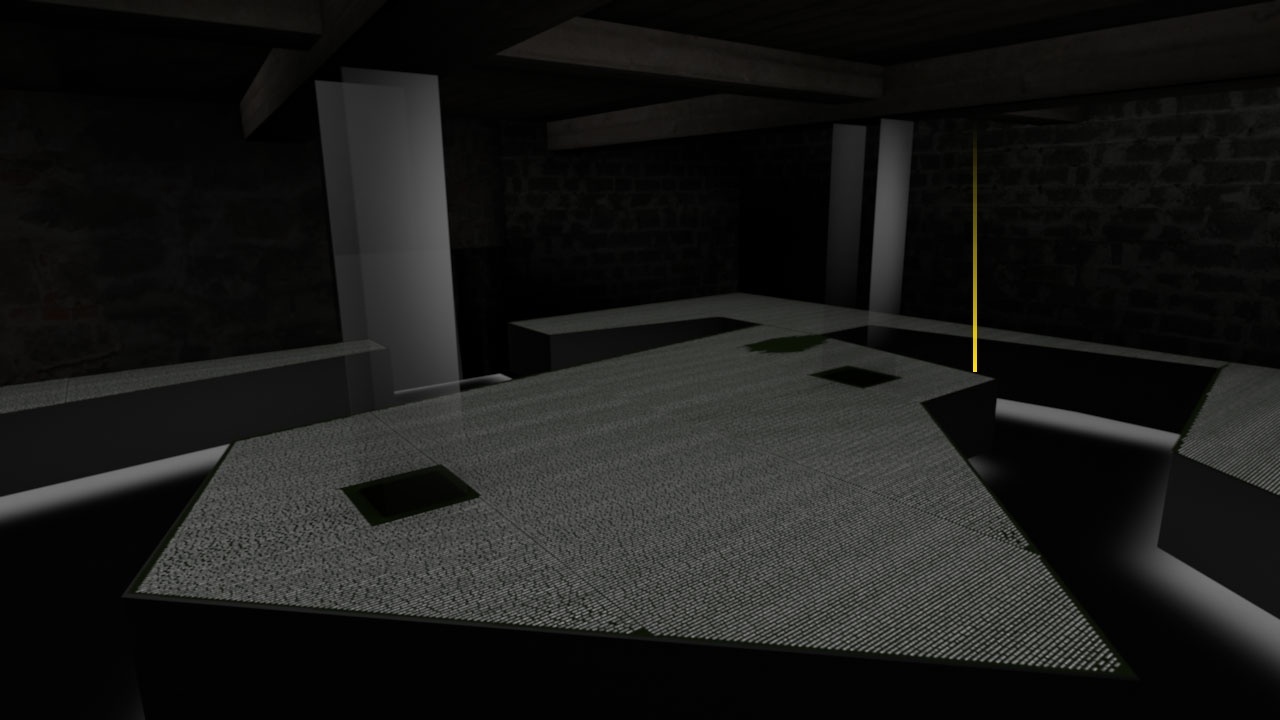Franz Pfau 1910 - 1940
Geboren 1.1.1910 in Staad bei Rohrschach
Gestorben 7.5.1940 in Mauthausen
Biografie
Franz Pfau kam am 1. Jänner 1910 in Staad bei Rohrschach (Schweiz) auf die Welt. Als lediger Tiefbauarbeiter zuletzt in Ravensburg bei seiner Mutter wohnhaft, wurde er im April 1938 auf Anordnung der Staatspolizeileitstelle Stuttgart verhaftet. Dies erfolgte im Rahmen der „Aktion Arbeitsscheu Reich“, einer großangelegten Verhaftungsaktion gegen vermeintlich sozial unangepasste Personen. Der Landrat von Ravensburg hatte, nachdem das Ortsfürsorgeamt Ravensburg Pfau als „arbeitsscheu“ gemeldet hatte, diese Information der Staatspolizeistelle Stuttgart weitergeleitet. Demnach habe Pfaus Mutter ihn als „arbeitsscheu“ bezeichnet und aufgrund seines Nichtarbeitens „schon wiederholtemal [sic] das Ortsfürsorgeamt in Anspruch nehmen“ müssen.
Auf Anordnung der Staatspolizeileitstelle Stuttgart verhafteten Beamte des Städtischen Polizeiamts Ravensburg Pfau am 21. April 1938. Im lokalen Polizeigefängnis wurde er vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und amtsärztlich auf seine Arbeitsfähigkeit hin untersucht. Am 10. Mai 1938 überführte die Polizei ihn per Bahn in das „Polizeigefängnis II in Stuttgart zur Verfügung von Schutzhaftkommandant Buck“. Pfaus Transport und Einweisung in das Konzentrationslager Buchenwald erfolgte am 4. Juni 1938. Dort wurde er wahrscheinlich wie die anderen Betroffenen der Verhaftungen im Rahmen der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ durch einen schwarzen Winkel auf der Kleidung als Angehöriger der Häftlingskategorie der „Asozialen“ kenntlich gemacht. In Buchenwald erhielt Pfau die Häftlingsnummer 4841. Er wurde dem Arbeitskommando Eickhoff zugeteilt und in Block 31 untergebracht. Nach seiner Verlegung in das Konzentrationslager Mauthausen am 15. April 1940 bekam er dort die Häftlingsnummer 2817. Franz Pfau starb am 7. Mai 1940, somit nur knapp drei Wochen nach seiner Ankunft in Mauthausen. Als Todesursache wurde in seiner Todesmeldung „Lungen- und Rippenfellentzündung“ angegeben.
Jens Kolata
Jens Kolata studierte Neuere und Neueste Geschichte sowie Soziologie an den Universitäten Tübingen (D) und Groningen (NL). Er ist seit 2007 als Mitarbeiter beim „Arbeitskreis Universität Tübingen im Nationalsozialismus“ am dortigen Institut für Ethik und Geschichte der Medizin u. a. mit Recherchen über nationalsozialistische Medizinverbrechen an der Universität Tübingen beschäftigt.
Quellen:
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Totenbuch des SS-Standortarztes Mauthausen, Y/46a.
Hauptstaatsarchiv Weimar, Einlieferungsbuch 21.5.1938-10.11.1938, KZ u. Hafta. Buchenwald 4, Band 2.
International Tracing Service (ITS), Totenbuch des KL Mauthausen 7.1.1939-31.12.1940, Digitales Archiv, 1.1.5.3.: Doc. No. 6813809; 1.1.26.1, Ordner 71 (orig. OCC 15/30a), lfd. Nr. 1654.
Kreisarchiv Ravensburg, B.1. RV, Bü 286, Schreiben des Ortsfürsorgeamts Ravensburg vom 28.2.1938, Schreiben des Polizeiamts Ravensburg vom 22.4.1938, Schreiben an die Staatspolizeileitstelle Stuttgart vom 23.4.1938, Transportschein vom 9.5.1938,.
Literatur:
Jens Kolata: Die Aktion ,Arbeitsscheu Reich’ in Württemberg und Hohenzollern. Eine Verhaftungsaktion der Gestapo aus regionaler Perspektive. In: Kai Michael Becker/Denis Bock/Henrike Illig (Hg.): Zwangsarbeit, Ausbeutung und Kriegswaffenproduktion. Ergebnisse des 18. Workshops zur Geschichte und Gedächtnisgeschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (Berlin 2015), S. 118–141.
Position im Raum