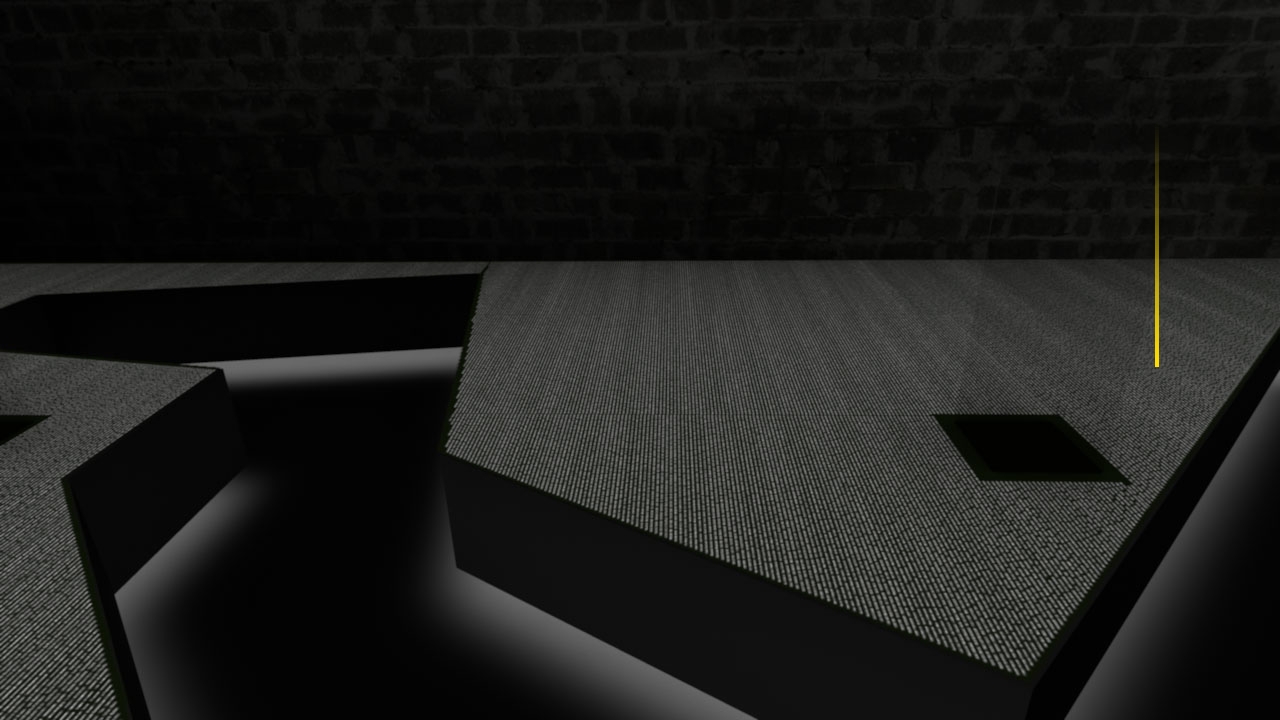Ildefonso Nalda Nájera 1876 - 1941
Geboren 23.1.1876 in Tricio
Gestorben 4.4.1941 in Gusen
Biografie
Ildefonso Nalda Nájera wurde 1876 in Tricio geboren, einer Ortschaft in der spanischen Provinz von Logroño (heutige Autonome Gemeinde von La Rioja). Im Jahr 1936, bereits 60 Jahre alt, arbeitete er noch immer als Landwirt. Er war verheiratet mit Felisa Pérez-Caballero, hatte gemeinsam mit ihr sieben Kinder und stand in politisch-ideologischer Hinsicht der Partei Izquiera Republicana (Republikanische Linke) nahe.
Carlos Muntión beschreibt in der Zeitschrift Piedra de rayo[1] die Umstände, weshalb Nalda Nájera aus Spanien fliehen musste – lange vor dessen Tod im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen. Das spannungsgeladene politische Klima, das kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg herrschte, hatte zu Fällen von Belästigungen gegen die Familie Nalda geführt. Am 23. April 1936 ernannte die Wahlkommission Ildefonso zum Kandidaten als Wahlmann für die Wahl zum Präsidenten der Republik. Die Wahlen zum Wahlmann fanden am 26. April statt und der Wahlboykott der Rechten brachte eine Wahlenthaltung von 75 Prozent in Tricio hervor. Ildefonso Nalda erhielt die Stimmen von 37 NachbarInnen. Nach den zunehmenden Belästigungen, die er erleiden musste, entschied sich Ildefonso schließlich, nach Nájera zu ziehen, in die Hauptstadt der Gegend und Ortschaft in zwei Kilometer Entfernung von Tricio.
Am 18. Juli brach der Krieg aus, und aufgrund der dadurch weiter erschwerten Situation und der möglichen Folgen für die Familienmitglieder entschlossen sich Ildefonso und seine drei ältesten Kinder (Luis, Doroteo und Feliciano) einen Tag darauf, in den nahegelegenen Feldern Schutz zu suchen. Ildefonso aber, sein gleichnamiger 15-jähriger jüngster Sohn, den alle nur Fonsito nannten, versuchte vergeblich, nach Madrid zu fliehen. Nach einem misslungenen Fluchtversuch traf er nach einiger Zeit seinen Vater und seine Brüder wieder.
Eine Woche nach der Flucht von Ildefonso Nalda und seinen Söhnen organisierten die franquistischen Truppen eine Treibjagd, um die Fliehenden von den Bergen des Camprovín zu vertreiben; Feliciano, 27 Jahre alt, wurde isoliert, verhaftet und in das Gefängnis Fronton[2] in Beti-Jai in Logroño eingeliefert, wohin auch seine Schwestern Elisa und Araceli aus dem Gefängnis in Martutene, San Sebastián, überstellt wurden.
Während der Monate Juli bis September harrten Ildefonso und seine drei Söhne auf der Flucht in den Bergen aus. Sie bewegten sich nur zwischen nahegelegenen Ortschaften der Zone. An die Guardia Civil (Zivilgarde) verraten, wurden sie in der Nacht des 6. Oktober eingekesselt und im Morgengrauen beim Verlassen der Hütte, in der sie übernachtet hatten, beschossen. Luis (35 Jahre) und Doroteo (29 Jahre) starben an Ort und Stelle; der Vater, verletzt, schaffte es, zu fliehen. Er gelangte nach Nájera, traf dort auf seinen Sohn Fonsito, und die beiden beschlossen, sich wieder in den Bergen zu verstecken. Einen Monat später, hungrig und ohne Nahrungsmittel, mussten sie zurück nach Nájera, um Essen zu besorgen, und wurden dabei entdeckt. Fonsito wurde am 8. November um 5 Uhr nachmittags beim Versuch, den Fluss Najerilla zu überqueren, verhaftet. Er verblieb bis zum 3. Dezember im Gefängnis von Nájera und wurde schließlich, nach einem Prozess im Jugendgericht von Logroño, für mehr als ein Jahr in einer Erziehungsanstalt interniert.
Drei Stunden vor der Verhaftung von Fonsito wurde auch seine Mutter Felisa verhaftet und ebenfalls in das Gefängnis von Beti-Jai gebracht. Dort traf sie ihre beiden Töchter Elisa und Araceli wieder. Die drei Frauen der Familie verbrachten mehr als ein Jahr in Beti-Jai. Am selben Ort befand sich auch ihr Sohn Feliciano in Gefangenschaft, dieser wurde aber am 14. Dezember vom Frontón geholt und an einem als Barranca (Schlucht) bekannten Ort in der Ortschaft Lardero, nahe der Hauptstadt Logroño, erschossen. Jesús Vicente Aguirre bestätigt, dass die drei ältesten Söhne von Ildefonso Nalda (Luis, Doroteo und Feliciano) ebenfalls erschossen wurden.[3]
Ildefonso Nalda befand sich weiterhin auf der Flucht. Ein kinderloses Ehepaar konnte ihn in ihrem Haus in Camprovín aufnehmen, bis er sich mit seinem Bruder Felipe Nalda, der in der nahegelegenen Ortschaft Huércanos lebte, in Kontakt setzte. Felipe richtete eine Scheune als kleinen Zufluchtsort für Ildefonso ein. Dort verweilte er zwei ganze Jahre.
Aus dem Gefängnis und der Erziehungsanstalt befreit, wurden Fonsito, seine Mutter und seine Schwestern von einer Frau in der Straße Caballerías 21 in Logroño aufgenommen. In dieses Haus gelangte schließlich auch Ildefonso Nalda, versteckt im Inneren eines Autos. Ohne je einen Fuß auf die Straße gesetzt zu haben, wohnte er dort bis zum April 1939, dem Kriegsende. Doch durch die weiter andauernde Verfolgung des franquistischen Regimes entschied sich die Familie, nach San Sebastián umzusiedeln. Dort mussten sie im Untergrund leben, und vor lauter Angst erkannt zu werden, floh Ildefonso – wie viele andere spanische Flüchtlinge – nach Frankreich. Am 9. September, gerade am Anfang des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Beteiligung Frankreichs in diesem, gelangte Ildefonso mithilfe eines Fluchtnetzwerks über die Pyrenäen von Navarro auf französischen Boden.
Die Niederlage der Republikaner in Spanien und die darauffolgende Ankunft tausender spanischer Exilierter veranlasste die französische Regierung zur Gründung von „Auffanglagern“. Das Lager in Gurs, in der Nähe von Pau, wurde mit der Beteiligung der baskischen Exil-Regierung im Frühling 1939 erbaut. Carlos Muntión findet dokumentarische Zeugnisse, die belegen, wo sich Ildefonso vor der Ankunft an seinem letzten Schickalsort aufhielt: zuerst im Lager von Gurs, nahe der spanischen Grenze, im Department der atlantischen Pyrenäen der französischen Region Aquitania; und etwas später in einer Landwirtschaft im Department von La Charente, im Osten Frankreichs, ungefähr 350 Kilometer nördlich von Gurs.
Laut Sandra Checa, Ángel del Río und Ricardo Martín[4] siedelten sich im Department von La Charente zahlreiche spanische Flüchtlinge an, die von der Grenze dorthin gebracht wurden und in unterschiedlichen Ortschaften aufgenommen wurden. Außerhalb von Angoulême, der Hauptstadt von La Charente, wurde das Flüchtlingslager Les Alliers installiert.
Das deutsche Militär besetzte unter der Billigung der Kollaborationsregierung von Vichy am 24. Juni 1940 die Stadt Angoulême. Die Verwaltung von Les Alliers wechselte ohne bemerkenswerte gröbere Unterschiede. Doch nach einigen Wochen breiteten sich Gerüchte über die baldige Ankunft eines Zuges im Lager aus, der die Flüchtlinge zurück nach Spanien oder in die freie französische Zone bringen solle. Schließlich wurden am 20. August ohne irgendeine weitere Erklärung 927 Spanier in der Station Angoulême in den Zug gepfercht (später als „Konvoy der 927“ bezeichnet). Wie Adrián Blas Mínguez schreibt, kam der Zug drei Tage später, am 24. August, in Mauthausen an.[5] Von den 927 Deportierten wurden 377 Spanier in den Lagerschreibstuben registriert, von denen während der Zeit ihrer Internierung 357 ermordet wurden.
An diesem Tag wurden die Häftlingsnummern 3807 bis 4237 vergeben. Ildefonso bekam die Nummer 4219 zugewiesen.[6] Nach vier Jahren Verfolgung endete Ildefonsos Weg im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen, wo sich der Steinbruch Wiener Graben befand. Ende 1939 war Mauthausen bereits mit Häftlingen überfüllt, weshalb in ungefähr fünf Kilometer Entfernung begonnen wurde, das neue Lager Gusen zu erbauen, das sich nahe des Steinbruchs Kastenhofen befand. Im Mai 1940 wurde es fertig gestellt und später als Gusen I bezeichnet.
Nach Gusen wurden solche Häftlinge überstellt, die nach der Ankunft von neuen Deportierten für die Kapazität des Hauptlagers Mauthausen als überschüssig angesehen wurden oder welche sich in schlechterem gesundheitlichem Zustand befanden. Ildefonso Nájera – mit dem blauen Dreieck als „staatenlos“ gekennzeichnet, mit der Häftlingsnummer 10893 registriert und 65 Jahre alt – wurde nach Gusen überstellt, dem wahren Vernichtungslager. In dem sogenannten Totenbuch des Lagers Gusen wurde folgender Eintrag notiert: „910 / Span. / 10893 / Nalda Nagera Ildefonso / 23.1.76 / Tricio / Pleuritis / 4.4.41 / 7:30“.[7]
Alfonso Rubio Hernández
Alfonso Rubio Hernández ist Professor für Geschichte an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universidad del Valle (Cali, Kolumbien). Er ist Spezialist für Archivgeschichte und Sozialgeschichte der Schriftkultur. Jüngste Publikation: Los escribanos de la Villa de Medellín, 1675-1819. La representación de un oficio en la escritura de su archivo (2015).
[1] Carlos Muntión: Piedra de rayo. In: Revista riojana de cultura popular, Nr. 16 (2005), S. 10–26.
[2] Anm. d. Ü.: Fronton ist die Bezeichnung für ein typisch baskisches Ballspiel, das auch in La Rioja beliebt war bzw. ist. Gleichzeitig bezeichnet es auch den Ort, in dem dieses Spiel ausgeübt wird – eine Art Stadion.
[3] Jesús Vicente Aguirre: Aquí nunca pasó nada. La Rioja, 1936 (Logroño 2008), S. 961.
[4] Sandra Checa/Ángel del Río/Ricardo Martín: Andaluces en los campos de Mauthausen (Sevilla 2006), S. 120–121.
[5] Adrián Blas Mínguez: Campo de Gusen. El cementerio de los republicanos españoles. In: Memoria Viva, Asociación para el Estudio de la Deportación y el Exilio Español, Colección Monografías del exilio español 8 (Madrid 2010), S. 41–42.
[6] Vgl. Benito Bermejo/Sandra Checa. Libro Memorial: españoles deportados a los campos nazis, 1940-1945 (Madrid 2006), S. 465.
[7] Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Totenbuch des Standortarztes Mauthausen für Gusen, 1.1.6.1.
Position im Raum