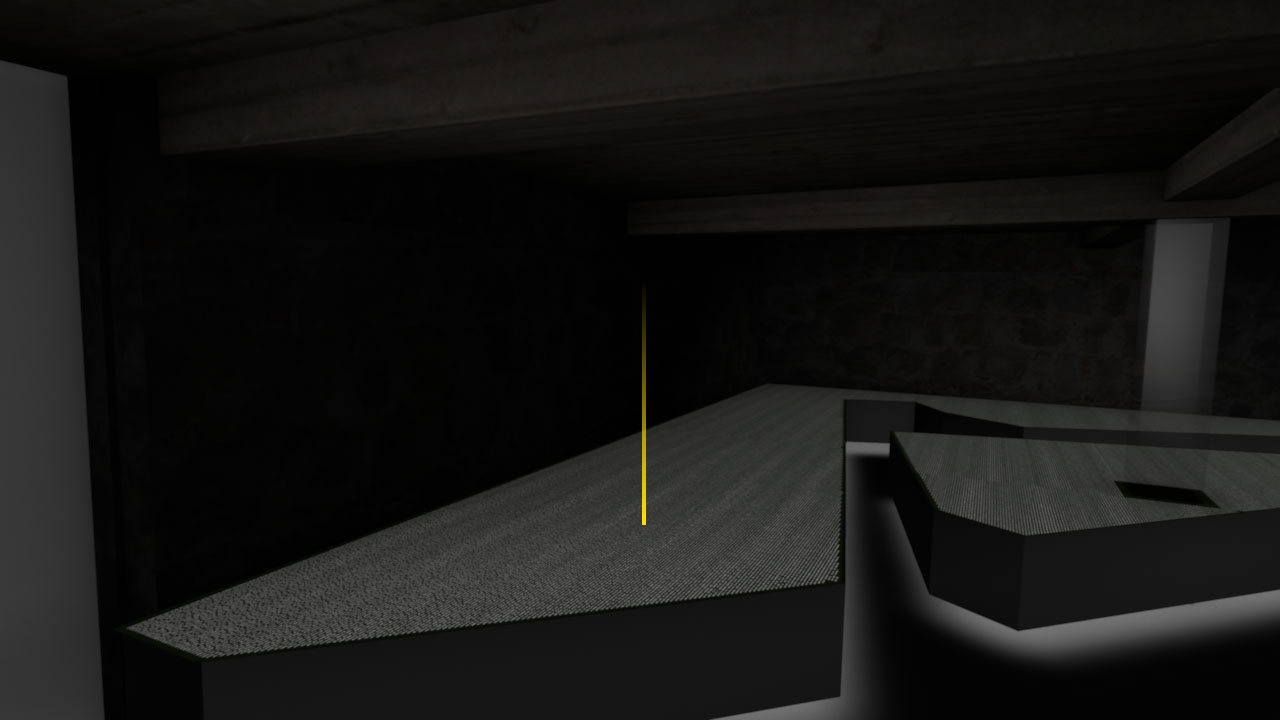Marcell Klang 1876 - 1942
Geboren 31.5.1876 in Wien
Gestorben 25.6.1942 in Mauthausen
Biografie
Marcell Klang war der Verfasser eines in jeder Hinsicht gewichtigen Werkes, mit 1126 Seiten und einem heute beachtlichen antiquarischen Verkaufspreis von 100 bis 250 Euro. Das Hauptgewicht dieses Werkes liegt jedoch darin, dass es ein ohne Nachfolge gebliebenes Nachschlagewerk ist. Marcell Klang unternahm 1936 den Versuch, Die geistige Elite Österreichs in einem Personenlexikon abzubilden. Das Werk erschien in einer erstaunlich modern wirkenden Ausgabe im Wiener Verlag C. Barth. Es wurde nicht die von den Nationalsozialisten ab 1933 als „deutsche Schrift“ propagierte Fraktur für das Buch verwendet, sondern die Antiqua. 1941 beendeten die Nationalsozialisten die Verwendung der Fraktur als Schrift des Nationalsozialismus und machten die Antiqua zu ihrer Schrift, die „Deutsch zur Weltsprache“ machen sollte. Die der Fraktur ähnlichen Lettern der „Schwabacher“ (Gotische Schrift) wurden bei der Schriftumstellung 1941 von den Nationalsozialisten als „Judenlettern“ klassifiziert, deren „Verwendung zu unterbleiben“ hatte.
Marcell Klang setzte denjenigen, die ihm inklusive der Veröffentlichung ihrer Adressen und Telefonnummern die Erlaubnis dazu gaben, in verblüffend variantenreichen, detailgetreuen Belobigungen Denkmäler, Politikern ebenso wie Beamten, Wirtschaftstreibenden oder Künstlern. Nicht zu übersehen ist, dass nur die politischen Repräsentanten des Ständestaates (die christlich-soziale Einparteiendiktatur von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß seit dem 4. März 1933, der am 25. Juli 1934 im Bundeskanzleramt ermordet wurde, und dem vom 29. Juli 1934 bis 11. März 1938 Kurt Schuschnigg als Kanzler nachfolgte) und nicht auch die der (verfolgten und verbotenen) Opposition in ihm enthalten sind. Welche Künstler aus welchen Gründen in ihm keine Aufnahme gefunden haben, ob sie nicht aufgenommen werden wollten oder von Klang nicht zur Aufnahme eingeladen waren, lässt sich anhand der dennoch vielfältigen Auswahl nur schwer einschätzen. Marcell Klang bezeichnet in seinem Vorwort die Zusammenstellung in dieser Ausgabe nur als einen ersten Schritt. Es fehlen auf jeden Fall zum Teil auch im Ständestaat geschätzte Autorinnen und Autoren wie Karl Kraus (gestorben 1936), Elias Canetti (Emigration in die Schweiz 1938), Hans Weigel (Emigration in die Schweiz 1938), Peter Hammerschlag (verschollen am Transport von Theresienstadt nach Auschwitz 1942), Jura Soyfer (an Typhus gestorben im KZ Buchenwald 1939), Stefan Zweig (Emigration nach London 1934), Joseph Roth (Emigration nach Paris 1933), Friedrich Torberg (Emigration in die Schweiz 1938), Hermann Broch (Emigration in die USA 1938), Leo Perutz (Emigration nach Israel 1938), Alfred Polgar (Emigration nach Paris 1938), Gina Kaus (Emigration nach Frankreich 1938), Franz Werfel (Emigration nach Frankreich 1938), Bertold Viertel (Emigration nach Frankreich 1938), Theodor Kramer (Emigration nach London 1939), Ödön von Horvath (Emigration nach Paris 1938), Hermynia zur Mühlen (Emigration nach England 1939). Viele von ihnen lebten zu dieser Zeit aber auch hauptsächlich außerhalb Österreichs oder waren Donaumonarchie-Österreicher.
Unter den bis heute bekannten Künstlerinnen und Künstlern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Autorinnen und Autoren finden sich im Lexikon u.a.: der Volkstheaterdirektor Rudolf Beer (Selbstmord, Mai 1938), der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud (Emigration nach London 1938 gegen Entrichtung der „Reichsfluchtsteuer“), der Autor Egon Friedell (Selbstmord, März 1938), der Kabarettist Fritz Grünbaum (Tod in Dachau 1941), der Architekt Clemens Holzmeister (Emigration nach Istanbul 1938), die Autorin Alma Johanna Koenig (ermordet im Vernichtungslager Maly Trostinec 1942), der Komponist und Oscar-Preisträger Erich Wolfgang Korngold (Emigration in die USA 1938), der Autor Jeremias Kreutz (Publikationsverbot ab 1933 in Deutschland und von 1938 bis 1945 auch in Österreich, mehrmonatige Haft 1944), der Autor Robert Musil (Emigration in die Schweiz 1938) und der Bildhauer Fritz Wotruba (Emigration in die Schweiz 1939).
Insgesamt enthält diese erste Ausgabe, bei der es geblieben ist und in der die handelnden Personen in den Jahren nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und der Errichtung des Ständestaates in Österreich widergespiegelt werden, 1.000 Würdigungen und Porträts und kein Inhaltsverzeichnis derer, die in diesem Band zu finden sind. Er selbst hat sich auf keinen Sockel gestellt und sich kein Denkmal gesetzt. Zum Herausgeber Marcell Klang gibt es in diesem Buch keine Angaben. Sein Name taucht vorher wie nachher nur ein einziges weiteres Mal in öffentlichen Zusammenhängen und allgemeinen Nachschlagquellen auf, im Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek, als Herausgeber der Wiener Wochenschrift „Die Sonne“ von 1916 bis 1918.
Marcell Klang kam am 31. Mai 1876 in Wien zur Welt. Er wurde 66 Jahre alt, am 25. Juni 1942, kurz nach seiner Einlieferung in das Konzentrationslager Mauthausen um 8.00 Uhr früh „auf der Flucht erschossen“, wie eines der schriftlich festgehaltenen Stereotype für die Ermordungen von Häftlingen in Konzentrationslagern hieß. Konkreter Grund für seine Verhaftung am 10. Februar 1942 durch die Gestapo war seine „unbefugte Sammeltätigkeit“ bzw. seine „Forderung von Unterstützungsgeldern“: „Der Jude Marcell Israel Klang [wurde] festgenommen, da er seit dem Jahre 1941 von Ariern Unterstützungsgelder gefordert hat. Er hat bisher von ungefähr 50 Personen, darunter 14 Parteimitgliedern, teils laufend monatlich RM 5,- bis 10,- erhalten. [Zum Vergleich: 10 RM monatlich musste z. B. die Familie von Gerhard Bronner 1938 für die Haft des Familienvaters und eines Sohnes in Dachau Gebühr bezahlen[1] – G.R.] Bei seinen Vorsprachen [bei den Spendern] hat er wiederholt die vom Staat ergriffenen Maßnahmen zur Lösung der Judenfrage [die von den Nazis ab 1941 angeordnete Zwangskennzeichnung der jüdischen Bevölkerung mit dem ‚Judenstern‘ und die ausgerufene ‚Endlösung‘ – G.R.] kritisiert und auch sonst seine ablehnende Haltung gegen den NS-Staat zu erkennen gegeben.“
Kein solches Denkmal, wie es Marcell Klang für mehr als 1000 andere von ihm Porträtierte in seinem Handbuch der Führenden in Kultur und Wirtschaft errichtet hat, aber wenigstens einen ständigen Platz für sein Lexikon hat er in der Bibliothek des Wiener Literaturhauses gefunden, mit dem folgenden Kommentar des Wiener Antiquariats, von dem es angeboten und bei dem es 2005, rund 70 Jahre nach seinem Erscheinen, erworben wurde: „Vorzugsausgabe; Seltenes, umfangreiches und ziemlich interessantes Personenlexikon“, und, wie zu ergänzen wäre, das nur durch einen geduldigen, gewaltigen und konsequenten Einsatz seines Verfassers über viele Jahre hinweg zustande kommen konnte.
Der C. Barth Verlag, in dem das Buch 1936 erschienen war, wurde, da er in „jüdischem“ Besitz war, 1938 „arisiert“. Der Verlagseigentümer Béla Hess konnte nach dem erzwungenen Verkauf des Verlags und seiner Druckerei nach England ausreisen.
Eines der Porträts in seinem Lexikon hat Marcell Klang seinem um ein Jahr älteren Bruder, dem österreichischen Rechtswissenschaftler Heinrich Klang gewidmet, dem er ebenfalls einen Denkstein setzen wollte, sowie dessen in acht Arbeitsjahren von 1927 bis 1935 fertiggestellten Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch in sechs Bänden. Heinrich Klang überlebte Theresienstadt, wo ihn die Nationalsozialisten vom 25. September 1942 bis zum 8. Mai 1945 als Richter zur Regelung von Verlassenschaften und Vormundschaften am Ghettogericht einsetzten. Sofort nach Kriegsende wurde er von den Alliierten wieder als Richter am Obersten Gerichtshof eingesetzt. Selbst die Arbeiter Zeitung verneigte sich anlässlich seines Todes am 22. Februar 1954 vor ihm, als „sozusagen letztem Liberalen in der Rechtswissenschaft“, obwohl er „kein Sozialist, sondern eher ein Gegner sozialistischer Auffassungen war“.
Gerhard Ruiss
Gerhard Ruiss, geb. 1951 in Ziersdorf (Niederöstereich), Autor, Musiker, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren. Bücher, u. a.: Nachdichtungen der Lieder Oswalds von Wolkenstein in drei Bänden (Bozen/Wien 2011), und Paradiese – Schöne Gedichte (Horn 2013). Stücke, u. a.: Das 100. Jahr (Uraufführung Feldkirch 2014).
[1] Zum weiteren Vergleich: „Am zweiten [Weihnachts-] Feiertag [1939] können wir in der Kantine eine verschimmelte Sülze kaufen, die der SS nicht mehr gut genug ist. Für ein Kilo bezahle ich zwölf Mark [...] Zum Glück hat mir meine Mutter einen kleineren Geldbetrag geschickt [...]“ (Erwin Gostner, Angehöriger der (österreichischen) Vaterländischen Front und KZ-Häftling in Mauthausen und Gusen von 1939 bis 1941 in seiner Eigenverlagspublikation 1000 Tage im KZ, gedruckt in der Wagnerschen Univ.-Buchdruckerei in Innsbruck 1945).
Position im Raum