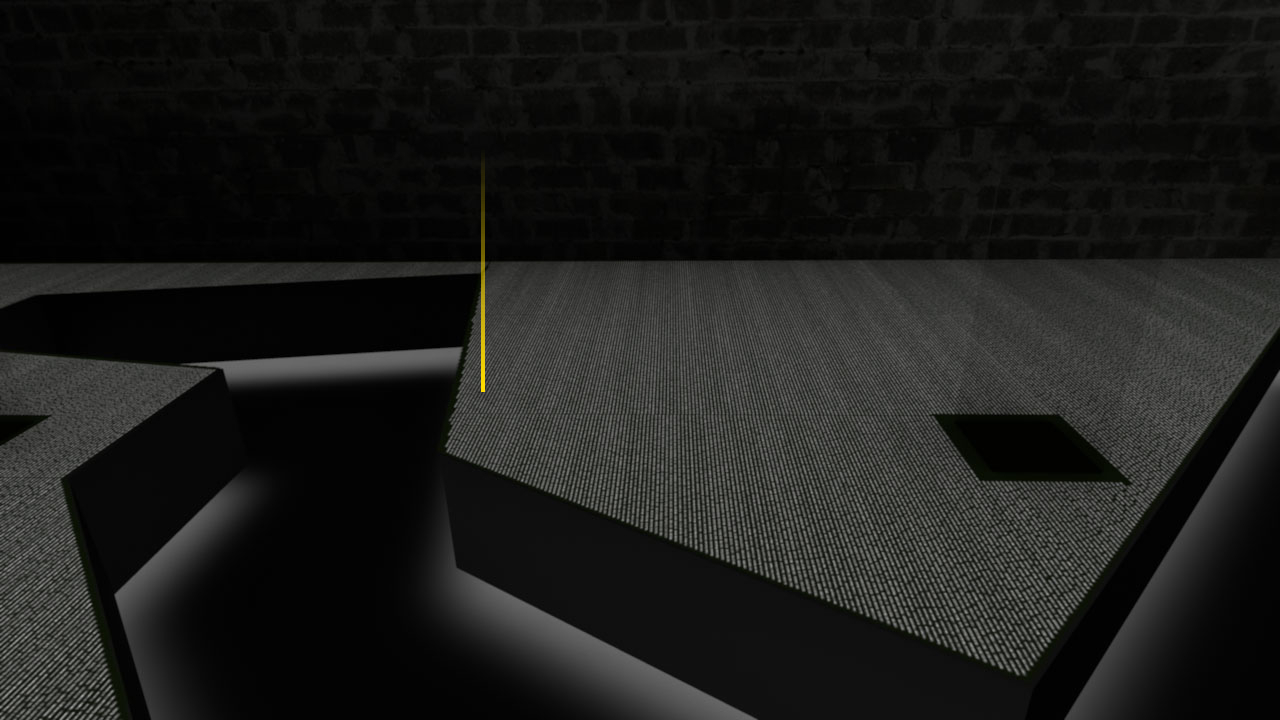Moritz Marxheimer 1871 - 1942
Geboren 28.2.1871 in Wiesbaden
Gestorben 27.10.1942 in Mauthausen
Biografie
Moritz Marxheimer wurde am 28.02.1871 in Wiesbaden geboren. Er war der Sohn des Lederhändlers Samuel Siegmund Marxheimer und Röschen Marxheimer (geb. Feist).[1]
Moritz Marxheimer hatte außerdem einen namentlich bekannten Bruder: Leopold Marxheimer, der ebenso wie sein Bruder Moritz am 01. September 1942 aus Wiesbaden deportiert wurde. Leopold Marxheimer wurde am 29. Oktober 1942 in Treblinka ermordet. Aus Dokumenten, die Finanzen Moritz Marxheimers betreffend, geht hervor, dass er noch weitere Brüder gehabt haben muss. So gab Moritz Marxheimer an, im Zeitraum von 1924 bis 1926 mehrere Darlehen an die Firma S. Marxheimer gegeben zu haben. Die Inhaber dieser Firma seien seine Brüder.[2] Konkretere Angaben über weitere Geschwister oder Familienangehörige liegen nicht vor.
Moritz Marxheimer besuchte das Humanistische Gymnasium am Luisenplatz in Wiesbaden.[3] Genaue Angaben über die Dauer seiner Schulzeit und über seine Zensuren sind leider nicht bekannt. Moritz Marxheimer legte sein Abitur 1889 ab.[4] Er studierte in Heidelberg, Berlin und Marburg Jura und unterbrach sein Studium für ungefähr ein Jahr, um seinen Militärdienst nahe Wiesbaden abzuleisten.[5]
Moritz Marxheimer war eines der insgesamt acht Gründungsmitglieder der jüdischen Studentenverbindung „Badenia“, welche am 26. Oktober 1890 in Heidelberg gegründet wurde.[6] Der Zusammenschluss in der Badenia sollte das selbstbewusste Einstehen für das Judentum innerhalb der Studentenschaft sowie die Abwehr antisemitischer Angriffe fördern.[7] Nach seinem Staatsexamen kehrte Moritz Marxheimer nach Wiesbaden zurück.[8] Er wurde am 26. Juli 1893 zum Referendar ernannt. [9] Seine Eintragung in die Liste, der beim Amtsgericht zu Wiesbaden zugelassenen Rechtsanwälte erfolgte am 10. Mai 1899, ebenso wie seine Vereidigung.[10] Während des Ersten Weltkriegs, wurde Marxheimer am 17. Juli 1917 zum Justizrat ernannt. [11] Seine Kanzlei befand sich in der Kirchgasse 7 in Wiesbaden.[12] Am 10. Juli 1919 erfolgte auf Verfügung des Justizministers die Ernennung zum Notar im Bezirk des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main.[13] Im Jahr 1921 gründete er zusammen mit den Rechtsanwälten Dr. Alfred Landsberger und Karl Weber eine neue Kanzlei, welche sich in der Luisenstraße 41 in Wiesbaden befand. Seine Kanzlei war sowohl in zivilrechtlicher als auch strafrechtlicher Hinsicht tätig und wurde als eine der größten Kanzleien der Stadt angesehen[14] und übernahm auch politische, gegen Nazis geführte Prozesse.[15] Nach 1933 verhalf Moritz Marxheimer etlichen seinen Gemeindemitgliedern zur Flucht.[16] Im Zuge der Nürnberger Rassengesetze verlor Moritz Marxheimer 1935 das Notariat.[17] Seine endgültige Streichung aus den Anwaltslisten erfolgte 1938.[18]
Moritz Marxheimer war von 1923 bis 1942 im Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Wiesbaden tätig. Er gehörte außerdem noch etlichen Vereinen an.[19] Vor dem Ausbruch des Krieges wurde Moritz Marxheimer mehrmals angeboten nach England auszuwandern. Er lehnte dieses Angebot stets ab und blieb in Wiesbaden, um sich auch weiterhin um die jüdische Gemeinde kümmern zu können.[20] Marxheimer wollte „[…] wollte die zurückgebliebenen Mitglieder ‚nicht im Stich lassen‘.“[21]
Moritz Marxheimer wurde im Sommer 1942 verhaftet.[22] Er wurde am 01. September 1942 im Rahmen der letzten großangelegten Deportation Wiesbadener Juden mit vorwiegend älteren Jüdinnen und Juden aus Wiesbaden in das KZ Theresienstadt deportiert. Am 23. Oktober 1942 erfolgte seine Verlegung in das KZ Mauthausen, wo er am 27. Oktober 1942 starb.[23]
Ellen Fähnrich, Forscherin
(Die Kurzbiografie beruht auf ihrer Bachelorarbeit "Moritz Marxheimer (1871-1942) Mitglied der jüdischen Studentenverbindung Badenia. Ein biografisches Beispiel für den Kampf gegen den Antisemitismus", eingericht bei der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 2023)
[1] Vgl. Katherine Lukat: E-Mail des Stadtarchiv Wiesbaden. 23.01.2023.
[2] Vgl. HHStAW, 685, 555. Finanzakten: „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“, S. 8f.
[3] Vgl. Katherine Lukat: E-Mail des Stadtarchiv Wiesbaden. 23.01.2023.
[4] Vgl. Rolf Faber/Karin Rönsch: Wiesbadens jüdische Juristen: Leben und Schicksal von 65 jüdischen Rechtsanwälten, Notaren, Richtern, Referendaren, Beamten und Angestellten. Wiesbaden 2011. S. 148-151, hier S. 148.
[5] Vgl. HHStAW, 467, 1546. Königliches Landgericht Wiesbaden. Personal-Acten über Referendar Marxheimer, S.16.
[6] Vgl. Max Mainzer: Badenia und K.C. Zum 25-jährigen Jubiläum der Badenia. In: K.C.-Blätter zum 26. Oktober 1915, S. 484.
[7] Vgl. Bericht der Badenia von 1895.
[8] Katherine Lukat: E-Mail des Stadtarchiv Wiesbaden. 23.01.2023.
[9] Vgl. HHStAW, 467, 1546. Königliches Landgericht Wiesbaden. Personal-Acten über Referendar Marxheimer.
[10] Vgl. HHStAW, 467, 1546, S. 35.
[11] Vgl. Faber/Rönsch 2011, S. 148.
[12] Vgl. Katherine Lukat: E-Mail des Stadtarchiv Wiesbaden. 23.01.2023.
[13] Vgl. HHStAW, 467, 1546. Königliches Landgericht Wiesbaden. Personal-Acten über Referendar Marxheimer, S. 39.
[14] Vgl. Faber/Rönsch 2011, S. 148.
[15] Vgl. Rolf Faber/Axel Ulrich: Im Kampf gegen Diktatur und Rechtslosigkeit – für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Ein Klarenthaler Straßen-ABC des Widerstandes und der Verfolgung in 21 Lebensbildern. In: Peter Joachim Riedle (Hrsg.): Wiesbaden und der 20. Juli 1944. Wiesbaden 1996, S. 189.
[16] Vgl. Faber/Ulrich 1996, S. 189.
[17] Vgl. ebd.
[18] Vgl. ebd., S. 148f.
[19] Vgl. ebd.
[20] Vgl. ebd., S. 150.
[21] Vgl. ebd.
[22] Vgl. Faber/Rönsch 2011, S. 150.
[23] Vgl. Florian Guschl: E-Mail der Gedenkstätte Mauthausen. 03.02.2023.
Position im Raum