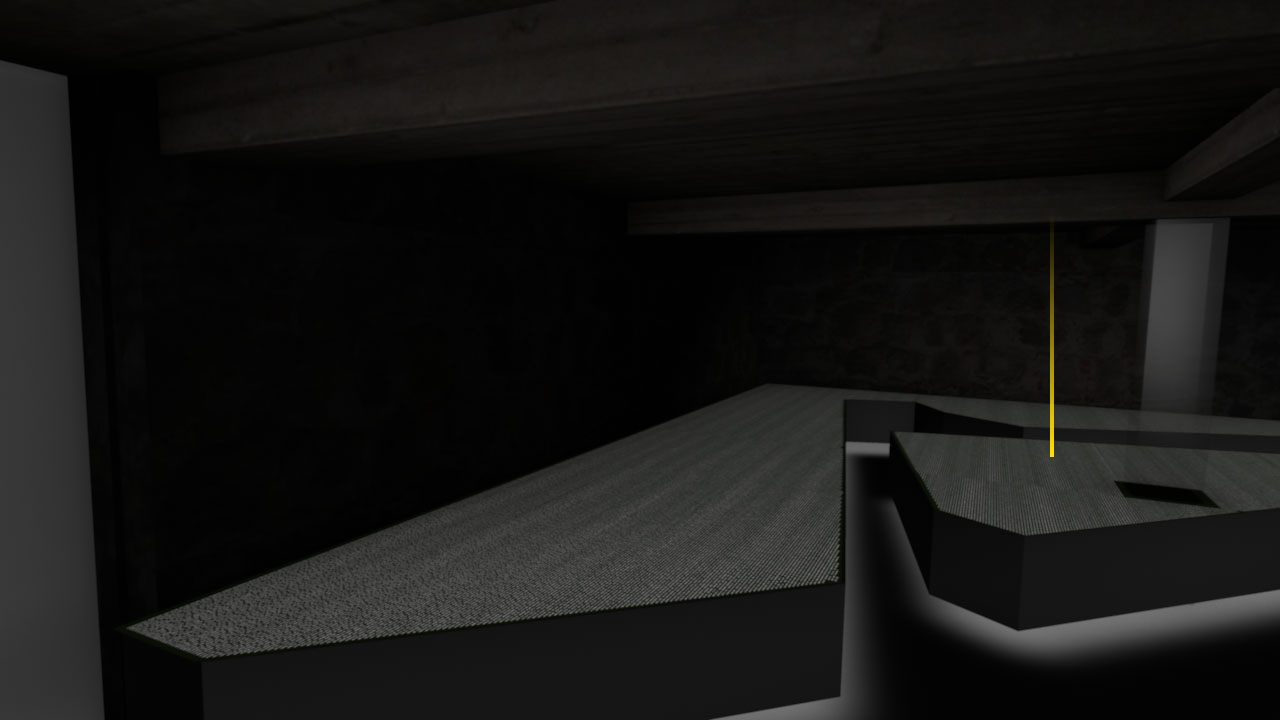Ludwig Ferneböck 1882 - 1942
Geboren 7.7.1882 in Wien
Gestorben 16.12.1942 in Mauthausen
Biografie
Das Wenige, das ich von meinem Großonkel weiß, habe ich zu Hause aufgeschnappt und, vor ein paar Jahren, durch Unterlagen im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes erfahren. Dort befinden sich auch zwei oder drei Briefe, die das Ehepaar Ludwig und Amalie Ferneböck wechseln durfte, im Spätherbst 1942, nachdem Ludwig von Gestapobeamten verhaftet und in das Landgericht Wien eingeliefert worden war. Die Briefe hatte meine Großtante Amalie, geborene Pölzer, dem Archiv überlassen. Sie besuchte uns regelmäßig in unserem Haus in Sittendorf und erzählte gern von ihrem Leben an Ludwigs Seite, es hätte also nicht an Gelegenheiten gemangelt, sie nach den genauen Umständen seiner Festnahme zu befragen. Aber davor schreckte ich zurück; ich wusste von ihrer innigen Liebe und wollte Tante Maltschi, wie wir sie nannten, nicht verletzen.
Die beiden waren in Alter und Herkunft sehr verschieden. Ludwig Ferneböck, Jahrgang 1882, stammte aus einer wohlhabenden Familie – sein Vater war Schuhfabrikant gewesen – und hatte eine wesentlich jüngere Schwester namens Hansi, die er gern verwöhnte. Er galt als lebenslustig, sah gut aus und legte großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums absolvierte er das Studium der Rechtswissenschaften und arbeitete nach der Promotion in einer Bank, vermutlich der Länderbank. Als deren Vertreter war er von 1925 bis 1936 Kollektivprokurist und Vorstandsmitglied der Schokoladenfabrik Küfferle. Möglich, dass er vor seiner Bankenkarriere im höheren Staatsdienst tätig war, das würde erklären, warum er den Titel Ministerialrat führte. Bei der Volksabstimmung 1921 über die Frage, ob das Burgenland bei Ungarn bleiben oder sich Österreich anschließen sollte, war er Abstimmungsleiter im Bezirk Ödenburg/Sopron gewesen. Und er war Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Meine Großtante und er lernten einander Anfang der 1920er-Jahre im Büro des Staatskanzlers Karl Renner kennen. Maltschi war 17 Jahre jünger als er und stammte aus einer legendären sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Ein Gemeindebau in Favoriten ist nach ihrem Vater, dem „Volkstribun“ Johann Pölzer, das Amalienbad nach ihrer Mutter benannt. Sie selbst war, mit kaum 20 Jahren, Renners Sekretärin geworden und in dieser Eigenschaft bei den Friedensverhandlungen in Saint-Germain dabei gewesen. Ludwig und Maltschi heirateten bald nach ihrer ersten Begegnung. Meine Großtante quittierte ihre Stellung und war fortan Hausfrau. Die Ehe blieb kinderlos, vielleicht mit Absicht, denn die beiden gingen gern aus, ins Theater, in die Oper, hatten einen großen und gebildeten Bekanntenkreis und genossen das Leben in vollen Zügen. Von Ludwig hieß es in meiner Familie, er sei charmant und Seitensprüngen nicht abgeneigt gewesen. Auf dem einzigen Foto, das ich von ihm gesehen habe, trägt er eine Fliege. Ein schöner runder Kopf, Glatze, weißer Haarkranz, weder Schnauzer noch Vollbart. Ich schätze, er war zum Zeitpunkt der Aufnahme 50 oder 55 Jahre alt.
Mein Vater erzählte, dass er als Gymnasiast von Onkel Ludwig und Tante Maltschi sonntags öfter zum Essen eingeladen wurde. Der Ablauf war immer derselbe: Nach dem Essen bestand Ludwig darauf, sich mit dem 15- oder 16-jährigen Neffen ins Herrenzimmer zurückzuziehen, um genüsslich eine Zigarre zu rauchen. Die Einwände meiner Großtante, der Bub sei fürs Rauchen noch viel zu jung, fruchteten nicht. Ludwig legte auch großen Wert auf gute Bildung und bezahlte meinem Vater Englischunterricht. Beim Einmarsch der Deutschen Wehrmacht war er schon Pensionist.
Ich habe mich manchmal gefragt, weshalb Ludwig nach der Annexion Österreichs nicht – wie seine Schwester – ins Ausland geflüchtet ist. Nach den Nürnberger Rassengesetzen galt er als Halbjude, und allein schon wegen der vielen jüdischen Bekannten wird er die Gefahr sofort erkannt haben. Vielleicht gab er sich der Illusion hin, ihm persönlich werde nichts geschehen, weil er im Ersten Weltkrieg in der Armee gedient hatte. Oder er glaubte, die Ehe mit einer sogenannten Arierin werde ihn vor Verfolgung schützen. Viereinhalb Jahre lang blieb er auch tatsächlich unbehelligt. Der Grund für seine Verhaftung im Oktober 1942 ist unklar. Ludwig war, als Sozialdemokrat, antifaschistisch gesinnt und hatte seine Überzeugung nie verleugnet. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er im Widerstand tätig gewesen ist. Denkbar, dass er sich abfällig über das Naziregime geäußert hat. Am wahrscheinlichsten erscheint die Vermutung, dass er von einer Nachbarin denunziert wurde, die es auf Ludwigs und Maltschis schöne Wohnung in der Schwindgasse 14, Tür 8, abgesehen hatte. Denn nach seiner Festnahme wurde meiner Großtante mitgeteilt, dass ihr Mann freikommt, wenn sie die Wohnung räumt. Sie ging auf das Ansinnen ein und erhielt eine Wohnung in der Schmelzgasse, in der Leopoldstadt, zugewiesen, die sie mit drei anderen, ausnahmslos Ehefrauen jüdischer Männer, teilen musste. Bei meiner Recherche stellte ich fest, dass diese Wohnung schon zum Zeitpunkt der Verhaftung in einem Schriftstück der Gestapo als Adresse von Ludwig Ferneböck vermerkt war. Bei der Räumung der Wohnung in der Schwindgasse sei, so erinnerte sich meine dabei anwesende Großmutter, eine Nachbarin erschienen, um – wie sie sagte – die Wohnung zu besichtigen. Dabei habe sie sich über lose oder schadhafte Tapeten aufgeregt.
Ludwig starb am 16. Dezember 1942, kaum drei Wochen nach seiner Überstellung aus dem Wiener Landgericht, im Konzentrationslager Mauthausen. An Lungenentzündung, wie die Lagerkommandantur meiner Großtante mitteilte. Der Leichnam sei am 19. Dezember im staatlichen Krematorium eingeäschert worden. Die Urne, die angeblich seine Asche enthielt, wurde im Februar 1943 nach altkatholischem Ritus eingesegnet und am Evangelischen Friedhof in Wien 10., Matzleinsdorferplatz im Familiengrab der Familie Ferneböck beigesetzt.
Nach der Befreiung des Konzentrationslagers berichtete der Schreiber des Totenbuchs, ein ehemaliger Häftling, dass er im Totenbuch hinter dem Geburtsort all jener Verstorbener einen Punkt angebracht hat, deren Todesursache gefälscht wurde und die in Wahrheit ermordet wurden. Das ist auch bei Ludwig der Fall.
Am Vortag seiner Deportation hatte Ludwig geschrieben, dass er nicht wisse, was ihm eigentlich zur Last gelegt werde, und noch nicht einvernommen worden sei. Er war anscheinend guten Mutes und bat Maltschi, warme Kleidung für ihn abzugeben. Meine Großtante antwortete: „Daß du wegkommst, ist der härteste Schlag und ich zittere um Deine Gesundheit. – Sorge Dich nicht um mich, ich werde alles ertragen, wenn ich weiß, daß wir wieder zusammen sein können. Das Leben ohne Dich ist nicht lebenswert und wenn ich nicht die Hoffnung hätte, daß wir uns wiedersehen, so möchte ich es lieber heute wie morgen wegwerfen.“
In zweiter Ehe war Tante Maltschi mit Otto Strauss verheiratet, dem Bruder einer ihrer Mitbewohnerinnen in der Schmelzgasse. Strauss starb nach sechs Jahren an Herzinfarkt. Von da an lebte sie allein. Bald nach der Befreiung 1945 hatte sie einen Überlebenden von Mauthausen getroffen. Der Mann erzählte ihr, dass er gemeinsam mit Ludwig im Steinbruch gearbeitet habe. Dieser sei, mit Frostbeulen übersät, am Ende seiner Kräfte gewesen. „Ich halt es nicht mehr aus. Ich geh ins Krankenrevier.“ – „Tu das nicht. Wer dort reingeht, kommt nicht mehr lebend raus.“ – „Es ist eh kein Leben mehr“, habe Ludwig Ferneböck erwidert.
Er war, nach allem, was ich von ihm weiß, ein sehr würdevoller Mann. Deshalb klammere ich mich an die Vorstellung, dass er aus Würde nicht um sein Überleben gekämpft hat.
Eva Nagl-Pölzer
Eva Nagl-Pölzer, geb. 1956 in Wien, ist die Enkelin von Johann Pölzer, dem jüngeren Bruder von Amalie Strauss-Ferneböck. Ludwig Ferneböck ist ihr angeheirateter Großonkel. Die Fotos wurden von Frau Claudia Laub (Enkelin von Hansi Lienhard, der jüngeren Schwester von Ludwig Ferneböck) aus Córdoba, Argentinien, zur Verfügung gestellt. Die Biografie entstand unter Mitarbeit des Schriftstellers Erich Hackl.
Position im Raum