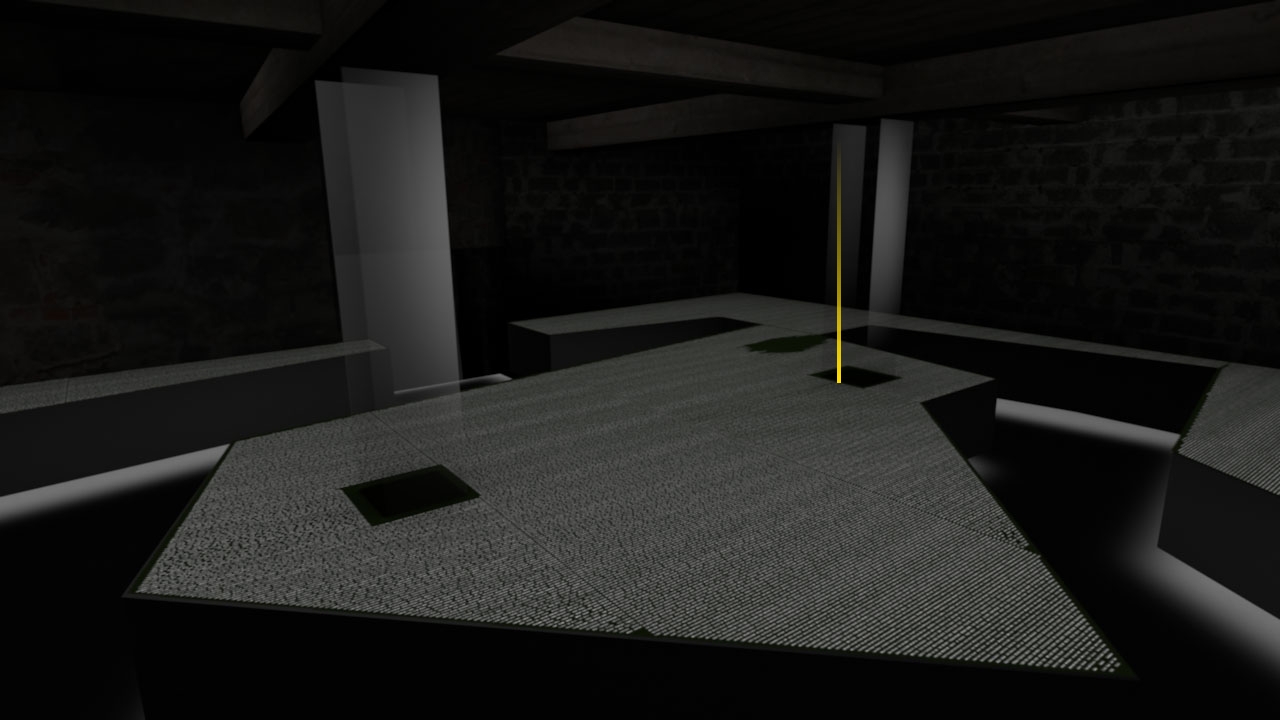Alexander Katan 1899 - 1943
Geboren 18.11.1899 in Rotterdam
Gestorben 27.1.1943 in Gusen
Biografie
Alexander Katan wurde in Rotterdam, Niederlande, geboren. Er war der Sohn von Israel Marcus Katan und Celli van Gelderen. Er arbeitete in verschiedenen Funktionen als kantoorbediende (Angestellter), unter anderem als Buchhalter und Rhetoriklehrer. Er war hoch gebildet und hatte ein Talent für Sprachen. Er heiratete Julia Sophia Elze (geboren am 12. September 1891 in Rotterdam, gestorben am 29. Juli 1942 in Auschwitz). Sie hatten einen Sohn, Alphons, der 1930 geboren wurde. Katan hatte Spondyloepiphyseal dysplasia, eine genetische Konstellation, die zu Zwergwuchs führte.
Unter deutscher Besatzung wurde er als Jude registriert. Er setzte sich über mehrere anti-jüdische Verordnungen hinweg und wurde verhaftet. Nach der Deportation in die Lager Leeuwarden und Amersfoort wurde er nach Mauthausen überstellt, wo er am 7. November 1942 als Häftling mit der Nummer 13992 registriert wurde. Kurz vor seiner Ermordung wurde er in Häftlingsuniform von vorne, hinten und von der Seite fotografiert, dann nackt; die Fotos wurden am 21. Juli 1943 an die SS-Ärztliche Akademie gesandt. Er wurde durch eine Herzinjektion getötet. Das war eine Technik, die von Standortarzt Eduard Krebsbach favorisiert wurde, der mit dem Aufbau einer pathologischen Sammlung von 286 menschlichen Organen im Lager Gusen betraut war. Das Fleisch wurde von Alexander Katans Skelett entfernt und das Skelett fotografiert. Krebsbach kontaktierte die SS-Ärztliche Akademie in Graz und teilte mit, dass ein Skelett eines Juden übermittelt werde.
Das Totenbuch Mauthausen nennt als Todesursache am 27. Jänner 1943 „eitrigen Dickdarmkatarrh“. Diese gefälschte Todesursache wurde oft benutzt, um vorsätzliche Tötungen in Konzentrationslagern und psychiatrischen Kliniken zu verschleiern. Im Jahr 2007 blieb ein Projekt, das den Verbleib von Katans Skelett ausfindig machen wollte, erfolglos.
Paul J. Weindling
Paul Weindling ist Professor für Geschichte am Department of History, Philosophy and Religion der Oxford Brookes University, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Autor u. a. des Buches Victims and Survivors of Nazi Human Experiments: Science and Suffering in the Holocaust (London 2014).
Literatur:
https://www.filmfestival.nl/publiek/films/dood-spoor-1 (Zugriff am 5.12.2015).
Ines Hopfer: Die Spur führt nach Graz. Auf der Suche nach den sterblichen Überresten eines NS-Opfers. In: Bundesministerium für Inneres (Hg.): KZ-Gedenkstätte Mauthausen | Mauthausen Memorial 2008. Forschung, Dokumentation, Information. Jahrbuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Wien 2009), S. 48–56.
Dan Kennedy: Little People. Learning to See the World through My Daughter’s Eyes (New York 2003).
Paul Weindling: Victims and Survivors of Nazi Human Experiments: Science and Suffering in the Holocaust (London 2014).
Position im Raum