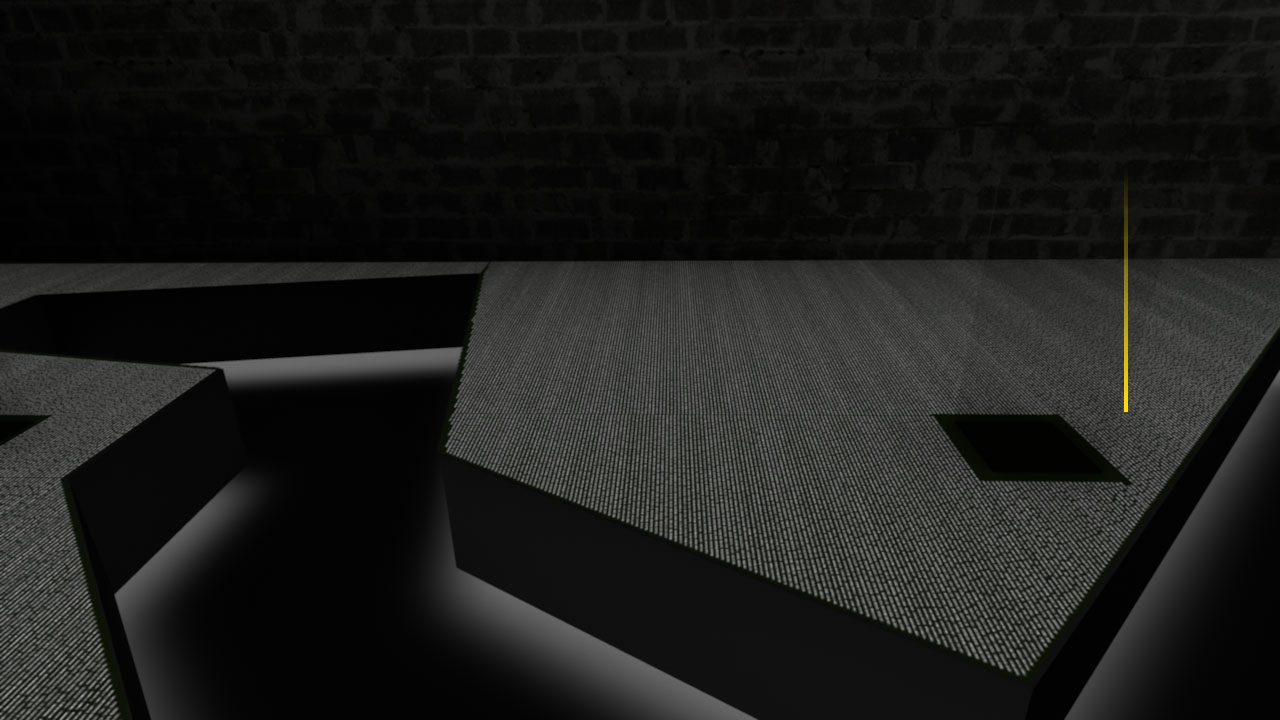Franz Paul Erath 1913 - 1940
Geboren 19.12.1913 in Dunningen
Gestorben 11.2.1940 in Mauthausen
Biografie
Franz Paul Erath kam in Dunningen im Landkreis Rottweil als das siebte von zehn Kindern zur Welt, von denen jedoch fünf kurz nach ihrer Geburt verstorben sind. Die Eltern Anna und Franz Xaver zogen 1932 mit ihren Kindern in die Uhrenstadt Schramberg im mittleren Schwarzwald um. Der Vater war Zimmermeister, die Mutter Hausfrau. Ihrer ausgeprägten religiösen Überzeugung war es geschuldet, dass sie für den einzigen Sohn eine Priesterausbildung vorsahen und den 13-Jährigen in dieser Absicht 1927 zur weiteren schulischen Ausbildung in das Missionshaus der „Weißen Väter“ in Haigerloch schickten. Ab der 10. Klasse wechselte er zusammen mit seinen Mitschülern ins Ordensinternat des Gymnasium Africanum im hessischen Großkrotzenburg bei Hanau. Dort legte er im Februar 1935 erfolgreich die Reifeprüfung ab.
Die Priesterlaufbahn schlug er nicht ein, blieb jedoch eng mit der katholischen Kirche verbunden. Laut seiner Schwester beabsichtigte er, Medizin zu studieren. Dies sollte ihm vorerst verwehrt bleiben, da er noch im Frühjahr 1935 zum „Reichsarbeitsdienst“ in Oberndorf am Neckar eingezogen wurde. Im Herbst kehrte er zu seiner Familie nach Schramberg zurück und begann bei der der Uhrenfabrik Gebrüder Junghans zu arbeiten.[1]
Ein früherer Schulkamerad erinnert sich an ihn als den besten Rechtsaußenspieler ihrer damaligen Fußballmannschaft und als einen, der, wenn er etwas als richtig ansah, unbeirrt daran festhielt. Der damalige Kaplan und spätere Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche in Schramberg schilderte ihn als „tiefreligiösen, charaktervollen Menschen, der häufig den Gottesdienst besuchte.“
Wie seine Mutter Anna war auch Franz Paul ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Die Mutter verweigerte die Annahme des Mutterkreuzes und hielt so wenig wie ihr Sohn mit ihrer Kritik am Nationalsozialismus hinterm Berg. Beide wurden denunziert, die Mutter von einer Mieterfamilie. Der Vorwurf, sie hätte den berüchtigten NS-Bürgermeister Fritz Arnold verleumdet, brachte sie ins Gefängnis. Franz Paul wurde vermutlich mehrfach denunziert, da er sich bei politischen Disputen in der örtlichen Gastwirtschaft und am Arbeitsplatz wiederholt kritisch zu Wort gemeldet hatte. Im Verlauf einer Debatte soll er gesagt haben, der Titel des Hitlerbuches Mein Kampf enthielte einen Schreibfehler, er müsse „Mein Krampf“ lauten.
Am 5. Juli 1937 nahm ihn die Gestapo an seinem Arbeitsplatz fest. In seiner Werkschublade wurde ein Tagebuch mit Aufzeichnungen seiner Einschätzung des NS-Regimes gefunden. Die erste Haftstation war das Gefängnis in Oberndorf am Neckar, von dort kam er ins Gestapo-Gefängnis in Welzheim. Nach seiner Verurteilung durch das Sondergericht Stuttgart im November 1937 ging es zurück nach Welzheim und am 3. Mai 1938 veranlasste die Gestapo die Überstellung des „Schutzhäftlings“ ins KZ Dachau. Nach Mauthausen kam Franz Paul Erath in einem großen Häftlingstransport am 27. September 1939. In einem Brief an seine Familie schrieb er am 29. November 1939: „Ich bin noch gesund und hoffe das Gleiche auch von Euch.“[2] Die Arbeit im Steinbruch „Wiener Graben“ hatte ihm zweieinhalb Monate später die letzte Kraft genommen. Beim Aufstieg auf die sogenannte Todesstiege, beladen mit einem schweren Stein, war er zusammengebrochen. Laut Sterbeurkunde erlag er am 11. Februar 1940 um 17:40 Uhr den Folgen einer „Nierenbeckenentzündung“.
Zwei damalige Mithäftlinge berichteten nach der Befreiung, dass Franz Paul Erath nach Arbeitsschluss von Mithäftlingen auf einer Trage zum Appellplatz gebracht und dort abgestellt worden war. Während des Häftlingsappells sei ein SS-Mann an die Trage heran getreten, habe seinen Stiefelabsatz auf die Kehle des Sterbenden gestellt und ihm mit dem Gewehrkolben das Gehirn eingeschlagen.
Die sterblichen Überreste von Franz Paul Erath wurden ins Krematorium nach Steyr überführt. Von dort erhielten die Eltern am 20. April 1940 eine Blechurne, die hinter der Friedhofskapelle auf dem Schramberger Friedhof kirchlich beigesetzt wurde.
Ingrid Bauz
Ingrid Bauz ist Angestellte im Bereich internationaler Schüleraustausch, Mitglied im Vorstand des Mauthausen Komitee Stuttgart e.V. und Schriftführerin des Comité International de Mauthausen. Zahlreiche Veröffentlichungen über Widerstand und Verfolgung während des Nationalsozialismus mit den Schwerpunkten KZ Mauthausen und Stuttgart.
Literatur:
Hans-Joachim Losch: Die KZ-Opfer des Nationalsozialismus in Schramberg (Schramberg 1982).
[1] Vgl. Senioren-Union Kreis Rottweil: Aufrecht und mutig – Frauen in der NS-Zeit im Landkreis Rottweil (Rottweil 2014).
[2] Ebd., S. 21.
Position im Raum